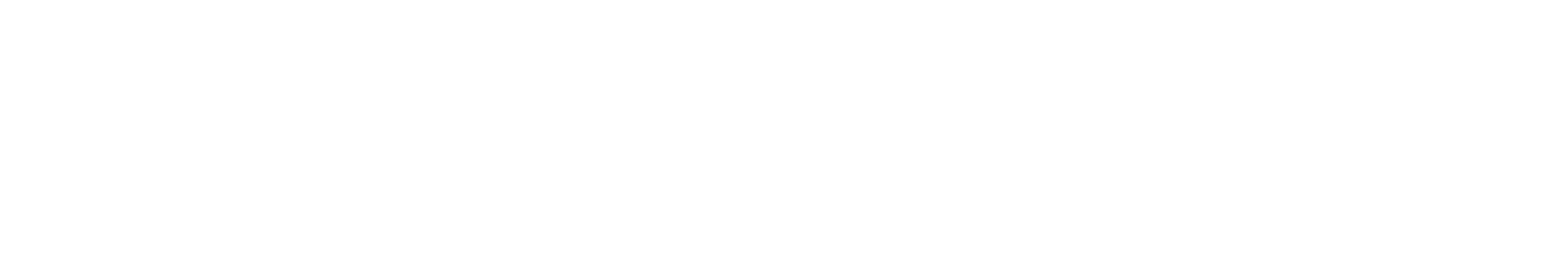Jährlich wird in Deutschland eine Fläche in der Größe von 100 Fußballfeldern betoniert, asphaltiert oder zugebaut. Genau dort sind häufig Überschwemmungen und Aufheizungen die Folge. Besonders in Großstädten sind zu wenig Grünflächen vorhanden.
Video: Aufbau und Arten von Dachgebrünung
Gründächer halten Niederschlag zurück
Über 90 % der deutschen Kommunen mit über 100.000 Einwohnern haben Gründächer in ihre Satzung aufgenommen, sei es durch Bauvorschriften, Förderprogramme, Gründachstrategien oder Gründachkataster. Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Gründächer können als hilfreicher Sicherheitspuffer zum Regenwasserrückhalt genutzt werden. Je nach Bauart halten sie 50-90 % der Niederschläge zurück. Diese natürliche Verzögerungstaktik minimiert das Regenaufkommen und entlastet die Kanalisation enorm. Ein Großteil dieses Wassers verdunstet, der Rest fließt zeitverzögert ab.
Zum Vergleich: Ein herkömmlicher und vielerorts bereits seltener ausgewachsener Stadtbaum verdunstet 300 bis 500 Liter Wasser am Tag. Ein 100 Quadratmeter großes, extensiv bepflanztes Gründach kommt bei guter Wasserversorgung auf dieselbe Größenordnung. Bei der Nutzung spezieller Pflanzenfamilien kann dieser Wert auf 700 bis 1.000 Liter pro Tag verbessert werden. Mittels Gründach entsteht durch Verdunstung und Kühlungseffekt ein verbessertes Klima im direkten Wohnumfeld.
Gute Gründe für ein Umkehrdach
Dass Flachdächer mittlerweile nicht nur dicht bleiben, sondern sogar zum Regenrückhalt genutzt werden können, liegt an den hoch leistungsfähigen Baustoffen, aber auch an technologisch durchdachten Konstruktionen wie dem Umkehrdach. Hierbei wird die Dämmschicht oberhalb der Dachabdichtung verlegt. Ein eigens dafür entwickelter Dämmstof stellt aufgrund seiner wasserresistenten und druckfesten Eigenschaften die optimale und tragfähige Basis für den Aufbau eines Gründachs dar. Die Wärmedämmung entlastet die Dachabdichtung und schützt sie zusätzlich.
Ein begrüntes Dach senkt die Temperaturschwankungen für eine Abdichtung um circa 30 Kelvin ab, verringert somit Schädigungen und verdoppelt dadurch die Lebensdauer des Flachdachs. Im Vergleich zum konventionellen Dachaufbau reduziert ein Gründach sowohl den Wärmeeintrag im Sommer als auch den Wärmeverlust im Winter um bis zu 19 %. Dazu kommen nochmals etwa bis zu 30 % an eingesparten Energieverlusten durch die Dämmung hinzu. Das bedeutet weniger Heizen im Winter und kühlere Räume an heißen Tagen.