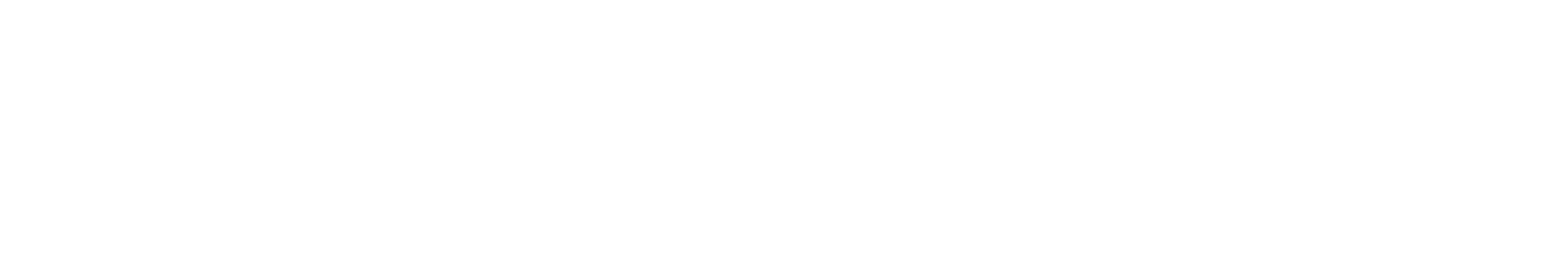Grüner Strom vom eigenen Balkon mit einer kleinen Solaranlage – gerade in Zeiten von Gasknappheit und hohen Strompreisen ist diese Option sowohl für Eigentümer als auch Mieter interessant.
Die Liste der Städte/Gemeinden, die einen Zuschuss geben, finden Sie weiter unten im Artikel – dieser wird fortlaufend aktualisiert. Außerdem finden Sie noch weitere Infos zur Funktionsweise von Stecker-Solargeräten.
Eintrag ins Marktstammdatenregister vereinfacht
Zum 1. April 2024 hat die Bundesnetzagentur die Registrierung von Balkonkraftwerken im Marktstammdatenregister (MaStR) vereinfacht. Auch die Nutzerführung im System wurde modernisiert.
► Direkt zum MaStR auf marktstammdatenregister.de
Menschen sollen so leicht wie möglich bei der Energiewende mitmachen können. Balkonkraftwerke können nun schnell und unbürokratisch registriert werden. Künftig müssen Betreiber neben den Angaben zu ihrer Person nur noch fünf Angaben zu ihrem Balkonkraftwerk eintragen. Vorher waren es rund 20 Angaben. Diese Vereinfachungen sind eine erhebliche Entbürokratisierung bei der Registrierung
, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.
Balkonkraftwerke z. B. mit 840 Wp – Upgradefähig, perfekt vorbereitet für die neue Gesetzesänderung!
→ bis zu 54 % Rabatt und sofort lieferbar – Jetzt Neu: auch mit Speicher!
Werbehinweis
Rechte der sollen Mieter gestärkt werden - nur wann?
Der Kabinettsbeschluss vom 13.9.23 sah laut einem Bericht der ARD vor, dass die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte in den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen werden soll. Das wären bauliche Veränderungen, die von Vermietern und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) nicht einfach blockiert werden könnten. Es bliebe zwar ein Mitspracherecht des Vermieters, defacto verbieten könnte er das Balkonkraftwerk dann aber nicht mehr.
Video: Balkonkraftwerke - 0 Bock mehr - Andreas Schmitz
Auf Anfrage des Portals Golem.de teilte die SPD-Fraktion mit, dass der im September 2023 vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf am 18. Januar 2024 in erster Lesung vom Bundestag beraten werden solle. Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes im ersten Quartal 2024 war daher nicht mehr zu rechnen.
Im Rahmen des Solarpakets I, das am 16.08.2023 im Kabinett beschlossen wurde, sollen Balkon-PV-Anlagen möglichst unkompliziert in Betrieb genommen werden. Hierfür soll die vorherige Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen und die Anmeldung im Marktstammdatenregister auf wenige, einfach einzugebende Daten beschränkt werden. Letzteres wurde jetzt für den 1.04.2024 umgesetzt.
Rückwärtslaufende Zähler sollten geduldet werden
Die Inbetriebnahme von Balkon-PV-Anlagen soll nicht dadurch behindert werden, dass zunächst ein Zweirichtungszähler eingebaut werden muss. Daher sollen übergangsweise bis zur Installation eines geeichten Zweirichtungszählers rückwärtsdrehende Zähler geduldet werden.
Schukostecker sollte ausreichen
Auch ist es Ziel, Balkon-PV mit dem Schukostecker zu ermöglichen. Die „Steckerfrage“ wird aber rechtlich nicht im Gesetz, sondern in technischen Normen geregelt. Die Norm wird derzeit durch den VDE (genauer DKE) überarbeitet. Um sicherzustellen, dass Balkonsolaranlagen z. B. in einem Mehrfamilienhaus mit einer Aufdach-PV-Anlage nicht zu dem Überschreiten von Schwellenwerten für die Aufdach-PV-Anlage führen, wird eine Ausnahme in den Regelungen zur Anlagenzusammenfassung vorgesehen. Die Einspeise-Schwelle soll von 600 W auf 800 W erhöht werden.
5 Vorschläge des VDE
- Einführung einer Bagatellgrenze bis 800 W
- Mini-Energieerzeugungsanlagen dürfen an jedem Zählertyp verwendet werden
- Vereinfachte Anmeldung und Inbetriebsetzung
- Duldung des Schuko-Steckers als Steckvorrichtung für die Einspeisung bis 800 W
- Sicherheitsvorgaben für Mini-Energieerzeugungsanlagen
Weitere Entbürokratisierung geplant
Der Deutsche Bundestag hat im März 2024 begonnen, über ein Gesetzespaket zur weiteren Beschleunigung des Solarzubaus zu beraten. Darin wird voraussichtlich auch geregelt, dass insbesondere bei Balkonkraftwerken die im MaStR einzutragenden Daten weniger werden. Beispielsweise soll bei Balkonkraftwerken nicht mehr nach der Ausrichtung der Anlage gefragt werden.
Zudem ist in dem Gesetzespaket vorgesehen, dass Balkonkraftwerke grundsätzlich nicht mehr beim Netzbetreiber gemeldet werden müssen. Eine Registrierung im MaStR wird dann ausreichend sein. Die Bundesnetzagentur informiert den zuständigen Netzbetreiber automatisch über das Balkonkraftwerk, das neu an sein Netz angeschlossen wurde. (Stand: 03.04.2024)
Video: Balkonkraftwerke max. 960W? - Andreas Schmitz
Wie werden Balkonkraftwerke gefördert?
Immer mehr Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bezuschussen die Anschaffung von Mini-Solaranlagen. Die Antragstellung ist meist unkompliziert, in vielen Fällen reicht eine Rechnungskopie und ein Fotonachweis über die sachgemäße Anbringung. Allerdings fallen die genauen Fördermodalitäten jedes Mal unterschiedlich aus, zudem kommen immer wieder neue Städte hinzu. Um sicherzugehen, ob Zuschüsse gewährt werden und wie hoch diese ausfallen, lohnt sich die Nachfrage bei der jeweiligen Gemeinde oder ein Blick in die jeweiligen Förderrichtlinien. Oft sind die Fördertöpfe auch begrenzt und werden im Laufe des Jahres ausgeschöpft – der Antrag sollte daher früh gestellt werden.
Förderungen: Höhe der Zuschüsse unterschiedlich
Wie hoch die Zuschüsse sind, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Die Stadt Weinheim gehört zu den Vorreitern der Förderung von Balkonmodulen. Bereits seit 2020 gibt es hier einen Fördertopf in Höhe von 2.000 Euro, der unter Umständen auch überschritten werden kann. Pro Modul wird ein Zuschuss von 50 Euro gewährt werden, möglich ist die Antragstellung für zwei Module – unterm Strich gibt’s also 100 Euro. Deutlich mehr Geld gibt es in Schwetzingen. Hier wird die Neuanschaffung eines Balkonkraftwerks mit bis zu 300 Euro gefördert, jedoch maximal 30 Prozent des Anschaffungswertes. Spitzenreiter in Baden-Württemberg ist die Stadt Heidelberg. Hier übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten bis zu 750 Euro. Bürger mit einem Heidelberg-Pass erhalten sogar bis zu 1.450 Euro Förderung bei einem Eigenanteil von 50 Euro.
Balkonkraftwerk mit Speicher kaufen:
Nutze Deinen Solarstrom, wenn Du ihn wirklich brauchst.
Werbehinweis
Diese Städte in BW fördern Balkonkraftwerke
- Bad Urach fördert den Aufbau eines Balkonkraftwerks mit 50 % der Anschaffungskosten bis zu einer Obergrenze von 200 €.
- Brühl übernimmt 50 % der Anschaffungskosten bei maximal 500 € pro Anlage (siehe Abschnitt VII. Absatz 1.) Punkt 3.))
- Dettingen unter Teck gibt einen Zuschuss von 50 Euro/Modul bzw. maximal 100 Euro pro Anlage
- Filderstadt fördert die Anschaffung von Steckermodulen mit 150 Euro pro Haushalt.
- In Freiburg gibt es bis zu 200 Euro pro Anlage und pro Antragsteller.
- Friedrichshafen (Punkt 7.5) fördert ab 300 Watt mit einem Zuschuss pauschal 300 € je Wohneinheit bzw. Stromzähler (gilt für Bestand und Neubau)
- Friolzheim zahlt pauschal 100 Euro für die Anschaffungskosten.
- Heddesheim fördert jedes Modul mit 100 Euro, maximal jedoch zwei Module.
- Heidelberg übernimmt seit September 2022 die Hälfte der Kosten für die Neuanschaffung eines Balkonkraftwerks bis zu 750 Euro, Inhaber des Heidelberg-Passes bekommen sogar 1.450 Euro bei einem Eigenanteil von 50 Euro.
- Hirschberg fördert jedes Modul mit 100 Euro, maximal jedoch zwei Module. Der Fördertopf umfasst maximal 15.000 Euro
- In Konstanz (Maßnahme B.8.) gibt es einen pauschalen Zuschuss zu den Anschlusskosten in Höhe von 200 Euro pro Anlage und Wohneinheit.
- Kehl bezuschusst im Rahmen des Förderprogramms „Klimafreundlich Leben“ jeden Antragsteller mit 200 Euro. Sozial Schwächere erhalten mit Nachweis über die Bedürftigkeit sogar 300 Euro.
- Lörrach fördert mit 200 Euro pauschal für max. 2 Module oder 600 Watt Peak
- Ludwigsburg fördert zwei Module bis 600 Watt, bzw. nach der Gesetzesänderung bis 800 Watt, mit 300 Euro pro Haushalt. Haushalte mit „Ludwigsburg Card“ erhalten im Stadtgebiet sogar eine Komplettförderung für ein Gerät. Diese umfasst das Solargerät mit Lieferung, Montage und Anschluss ans Netz (alle Infos dazu gibt's hier).
- Die Gemeinde Malsch gibt für die ersten 20 Anträge auf Errichtung eines Balkonkraftwerks einen einmaligen Zuschuss von je 50 Euro.
- In Neubulach gibt es einen Zuschuss von 50 Euro pro Modul, 100 Euro für zwei Anlagen.
- Schriesheim fördert Stecker-Solargeräte mit einem Budget von insgesamt 15.000 Euro. Für die Neuanschaffung von Balkonkraftwerken gibt es rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 150 Euro pro Wohneinheit.
- Schwaikheim gibt 200 Euro pro Haushalt dazu
- Schwetzingen fördert die Anschaffung einer Mini-Solaranlage mit bis zu 300 Euro, maximal aber 30 Prozent des Kaufpreises.
- Stuttgart gewährt im Rahmen der Solaroffensive einen pauschalen Zuschuss von 100 Euro pro Modul.
- Tübingen gibt bis zu einer Ausgangsleistung von 150 Watt bis 600 Watt Peak 250 Euro dazu, maximal 30 Prozent der förderfähigen Investitionskosten; KreisBonusCard Inhaber bekommen noch deutlich mehr (ab Seite 7 im PDF).
- Ulm fördert Stecker-PV-Anlagen mit 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit.
- Walldorf zahlt seinen Bürgern bis zu 300 Euro pro Wohneinheit, allerdings höchsten 50 Prozent der anrechenbaren Kosten (Förder-Richtlinie der Stadt Walldorf pdf).
- Weinheim zahlt pro Modul 50 Euro und bezuschusst maximal zwei Module.
Stand 6.8.23 (ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit)
Balkonanlagen mit höherer Leistung können Sinn ergeben
Je nach Ausrichtung der Module oder auch bei Verschattung, kann die Ausbeute selbst im Sommer bei kleineren Anlagen (2 Modulen) deutlich unter der Einspeisegrenze liegen. Hier bieten sich Balkonkraftwerke mit einer höheren Leistung bis zu 1.500 Watt an, die auch bei schlechten Wetterverhältnissen, Verschattung oder im Winter die Einspeisegrenze von 600 Watt bzw. zukünftig 800 Watt erreichen können.
Je nachdem, wie man den Strom über den Tag verteilt nutzt, kann es auch sinnvoll sein, den (überschüssigen) Strom tagsüber zu speichern und dann abends zu verbrauchen. Solche Anlagen mit Speicher sind zwar deutlich teurer, können sich aber langfristig trotzdem rechnen, da man ansonsten den überschüssigen Strom an seine Stromanbieter quasi verschenkt.
Die (alten) Stromzähler dürfen zwar in einer Übergangszeit auch rückwärts laufen, jedoch nur solange, bis die Zähler ausgetauscht werden.
Maßnahmen im einzelnen Solarpaket I:
- Meldepflichten vereinfachen oder streichen: Der Anschluss einer Balkon-PV-Anlage sollte möglichst einfach und unbürokratisch sein. Derzeit sind diese Anlagen sowohl im Marktstammdatenregister einzutragen als auch dem Netzbetreiber zu melden. Diese „Doppelmeldung“ wollen wir entschlacken.
- Rückwärtsdrehende Zähler vorübergehend dulden: Balkon-PV soll übergangsweise hinter jedem vorhandenen Zählertyp betrieben werden dürfen, einschließlich rückwärtsdrehender Ferrariszähler. Dies soll allerdings nur so lange geduldet werden, bis ein Zweirichtungszähler (im Regelfall eine moderne Messeinrichtung) installiert wird. Dazu werden wir Messstellenbetreibende verpflichten. Ein dauerhafter Betrieb der Balkon-PV-Anlage hinter rückwärtsdrehenden Zählern sowie eine Ausweitung dieser Regelung auf leistungsstärkere PV-Anlagen ist nicht geplant und wäre auch nicht sachgerecht. Es soll lediglich ermöglicht werden, das Steckersolargerät schon vor dem ggf. nötigen Zählerwechsel anschließen zu dürfen.
- Aufnahme von Balkon-PV in den Katalog privilegierter Maßnahmen im WEG/BGB: Der Betrieb eines Steckersolargerätes muss durch Wohnungseigentümergemeinschaften oder den Vermietenden genehmigt werden. Das BMWK plädiert dafür, die Balkon-PV in den Katalog privilegierter Maßnahmen aufzunehmen. Damit hätten Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer und Mietende einen Anspruch auf Zustimmung für den Betrieb ihrer Balkon-PV-Anlage. Die Zuständigkeit liegt beim BMJ.
- Anlagenzusammenfassung bei Balkon-PV: Die rechtliche Verklammerung einer Balkon-PV-Anlage mit einer bestehenden PV-Dachanlage oder mit weiteren Balkon-PV-Anlagen soll auch dann ausgeschlossen werden, wenn sich diese auf demselben Grundstück befinden. Anderenfalls könnten alleine durch die Inbetriebnahme einer Balkon-PV bestimmte Schwellenwerte z. B. hinsichtlich technischer Anforderungen überschritten werden.
- Schukostecker als „Energiesteckvorrichtung“ ebenfalls zulassen: Geregelt werden soll dies in der Produktnorm DIN VDE V 0126-95. Die Entwurfsfassung enthält im Anhang 1 eine ausführliche Diskussion des Brand- und Stromschlagrisikos bei Steckersolargeräten mit Schukosteckern. Im Ergebnis erscheint das Risiko gering, wenn der Schukostecker mit einem Modulwechselrichter kombiniert ist, der über einen Netz- und Anlagenschutz verfügt. Das Stromschlagrisiko ist vergleichbar mit anderen Haushaltsgeräten und das Brandrisiko wurde bei Nutzung von Wandsteckdosen als gering modelliert. Steckersolargeräte dürfen aber grundsätzlich nicht in Mehrfachsteckdosen gesteckt werden, dies könnte durch einen Hinweis am oder auf dem Kabel klargestellt werden. Das BMWK hat den Dialog mit den Normungsstellen aufgenommen. Stellungnahmen oder Positionen wurden von BMWK, Umweltbundesamt und Bundesnetzagentur eingereicht.
- Schwelle von 600 W auf 800 W erhöhen: Die EU-Verordnung „Requirements for Generators“, die Anforderungen an den Anschluss neuer Stromerzeugungsanlagen an das Stromnetz beschreibt, gilt nicht für Erzeugungsanlagen unterhalb von 800 W Wechselstromleistung. Mitgliedstaaten können davon abweichende Regelungen treffen. In Deutschland sind 600 Voltampere (VA, entspricht 600 W) in einer technischen Norm (VDE-AR-N 4105) als Obergrenze für die vereinfachte Anmeldung definiert. Hinsichtlich der vereinfachten Anmeldung sowie auch für die Produktnorm DIN VDE V 0126-95 hat das BMWK den Normgeber (VDE/DKE/FNN) gebeten, die Grenze auf 800 VA Wechselstromleistung zu erhöhen.
Maßnahmen Solarpaket II:
- Bauliche und technische Anforderungen an Balkon-PV weiter optimieren: Zum Teil hemmen auch bauliche Detailregelungen den einfachen und effizienten Zubau der Balkon-PV. Das BMWK wird sich für eine Vereinfachung dieser technischen Regelungen einsetzen. Das BMWK wird darüber hinaus die Entwicklung generell aufmerksam verfolgen und bei Bedarf weitere Anpassungen vorschlagen, damit Balkon-PV in Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger leicht umzusetzen ist.
► Das ganze Papier kann man sich hier herunterladen (PDF)
Quelle: bundesregierung.de
Was ist ein Stecker-Solargerät (Balkonkraftwerk) überhaupt und wo kann es eingesetzt werden?
Wie funktionieren die Steckermodule, was gibt es bei der Nutzung zu beachten und wo werden Balkonanlagen bezuschusst? Wir haben die wichtigsten Tipps und Infos zusammengefasst.
Mini-Solaranlagen sind Strom erzeugende Haushaltsgeräte für den Eigenbedarf und können maximal 600 Watt elektrische Leistung erzeugen. Privatpersonen können solche Stecker-Solargeräte selbst anbauen, anschließen und nutzen. Geeignet für den Aufbau sind Balkonbrüstungen, Außenwände, Dächer, Terrassen und Gärten.
Zusammengesetzt sind die Solargeräte aus Standard-Solarmodulen und einem Wechselrichter, der den Gleichstrom der Solaranlage in 230-Volt-Wechselstrom für Haushaltsgeräte umwandelt. So fließt der selbsterzeugte Strom in die Steckdose am Balkon und versorgt von dort Fernseher, Kühlschrank oder Waschmaschine, die an anderen Steckdosen in der Wohnung angeschlossen sind.
Video: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Test mit Akkudoktor
Eigener Solarstrom für Eigentümer und Mieter
Stecker-Solargeräte bestehen aus ein oder zwei Solarmodulen. Ein Modul hat die Größe von zwei kleineren Fußabtreter-Matten (ca. 1 x 1,70 Meter) und generiert eine Leistung von bis zu 300 Watt. Solche Mini-Solaranlagen bieten damit nicht nur Eigentümern, sondern auch Mietern die Möglichkeit, Solarstrom selbst zu nutzen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren.
Was kosten Stecker-Solargeräte?
300-Watt-Module samt Wechselrichter sind einschließlich Montagevorrichtung ab 350 Euro erhältlich und erzeugen je nach Standort bis zu 300 Kilowattstunden Strom im Jahr. Die meisten Modelle bewegen sich in einem Preisrahmen zwischen 400 und 1.000 Euro, je nach Leistung und Zubehör. Der Preisrahmen reicht bis knapp 3.000 Euro.
Rechnet sich so eine Mini-Solaranlage?
Je nach Haushaltsgröße können Balkonkraftwerke den Stromverbrauch um bis zu 20 Prozent reduzieren. Wann sich die Anlage rentiert, hängt dabei von den Anschaffungskosten, der produzierten Strommenge, und dem Strompreis ab. Oft dauert es nur noch rund fünf Jahre, bis sich die Solaranlage amortisiert hat, in anderen Fällen kann es auch 8 bis 10 Jahre dauern. In jedem Fall lohnen sich die Geräte, schließlich liefern hochwertige Module auch 20 bis 30 Jahre Solarstrom. Außerdem können die Mini-Anlagen unkompliziert bei einem Umzug mitgenommen oder anders platziert werden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
Checkliste für die Nutzung von Stecker-Solargeräten
- Erlaubnis: Für Miet- und Eigentumswohnungen bedarf es der Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft, um Solarmodule an der Brüstung oder Hauswand anbringen zu können. Eigentümer:innen können frei über die Anbringung an Balkon, Terrasse, Vordach oder Garage entscheiden (wird jetzt deutlich vereinfacht, siehe Gesetztes-Anpassung oben).
- Beim Kauf auf Sicherheitsstandards achten: Nur steckfertige Geräte kaufen und bei der Auswahl auf die Einhaltung des Sicherheitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS 0001:2019-10) achten.
- Module richtig ausrichten für maximalen Ertrag: Den besten Ertrag liefern Module, die unverschattet zur Südseite ausgerichtet sind. Die Geräte müssen sturmfest montiert sein.
- Stecker-Solargeräte anmelden und in Betrieb nehmen: Stecker-Solargeräte müssen beim örtlichen Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur (Marktstammdatenregister) angemeldet werden. Das entsprechende Formular dürfen Mieter/Eigentümer selbst ausfüllen. Leider erschweren einzelne Netzbetreiber den Anschluss von Stecker-Solargeräten oder verlangen unzulässige Entgelte für den ggf. notwendigen Zählertausch. Den Betrieb verbieten dürfen sie nicht (auch hier wird es in Zukunft deutlich einfacher werden).
Was muss ich noch über Stecker-Solargeräte wissen?
- Stecker-Solargeräte produzieren Solarstrom nur für den eigenen Bedarf. Sie sind nicht für eine Einspeisung ins Stromnetz gedacht.
- Mithilfe eines Strommessgeräts lässt sich überprüfen, wie viel Strom produziert wird. Manche Solargeräte haben auch einen Wechselrichter mit Leistungsmessung.
- An einen Stromkreis sollte immer nur eine Mini-Solaranlage angeschlossen werden. Niemals mehrere Solargeräte mit einer Mehrfachsteckdose verbinden!
- Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt einen Elektrofachbetrieb prüfen, ob der Stromkreis für die Solar-Einspeisung geeignet ist.